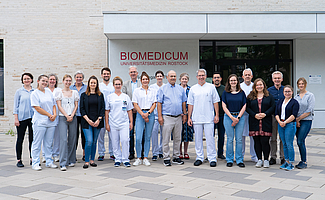Forschung und Wissenschaft
Experimentelle Forschung
Unsere experimentelle Forschung widmet sich den biologischen Grundlagen, der Diagnostik und der Therapie von Infektionskrankheiten. Ziel ist es, das Verständnis für Krankheitsmechanismen zu vertiefen und neue Ansätze für Prävention und Behandlung zu entwickeln.
Die Schwerpunkte reichen von parasitologischen Erkrankungen wie Schistosomiasis oder Malaria über opportunistische Infektionen wie Pneumocystis jirovecii bis hin zu innovativen Projekten zur Implantat-assoziierten Infektiologie und landesweiten Forschungsinitiativen in Mecklenburg-Vorpommern.
Schistosomiasis
Die Schistosomiasis ist nach der Malaria die häufigste Tropenerkrankung. Rund 200 Millionen Menschen sind weltweit mit Schistosomiasis infiziert. Der von uns in Süßwasserschnecken der Gattung Biomphalaria glabrata (Zwischenwirt) und Mäusen (Endwirt) gehaltene Schistosoma mansoni-Zyklus dient der Entwicklung neuer Therapieansätze im Bereich der frühen, akuten Phase der Erkrankung, der antifibrotischen Therapie und der Entwicklung einer geeigneten Prophylaxe zur Vermeidung der Infektion.
Pneumocystis jirovecii
Pneumocystis kann sowohl beim Menschen als auch bei verschiedenen Tierarten (u.a. Nager, Schweine, Katzen, Hunde und Pferde) schwere Pneumonien verursachen. Die Pneumocystis Pneumonie (PCP) war bisher die häufigste opportunistische Erkrankung bei HIV-Patienten. Heute sind in zunehmendem Maße auch Patienten mit hämatologisch-onkologischen Grunderkrankungen und andere Immunsupprimierte betroffen.
Die laufenden Forschungsprojekte befassen sich mit der Optimierung der PCP-Diagnostik mittels molekularbiologischer Methoden, der therapiebegleitenden Kontrolle von PCP-Patienten mittels Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR), der Überwachung von Risikopatienten (z.B. von HIV-positive Patienten) bezüglich einer Besiedelung mit P. jrovecii und der Untersuchung auf Sulfamethoxazol- sowie Trimethoprim-Resistenzen zur Therapieoptimierung.
Malaria und Sepsis
Jährlich sterben ca. 600.000 Menschen an Malaria tropica. Todesursache ist das Versagen lebenswichtiger Organe, zu dem eine Schädigung des Gefäßendothels wesentlich beiträgt. Ein Hauptmechanismus des Endothelzellschadens ist die Auslösung von Apoptose durch Sekretionsprodukte der neutrophilen Granulozyten. In vivo korrelieren erhöhte Plasmaspiegel der Elastase (Neutrophilenaktivierung) mit denjenigen des Thrombomodulins (Endothelschaden), und im Nieren- und Lungengewebe verstorbener Malariapatienten sind apoptotische Kapillarendothelzellen nachweisbar. In vitro führt die Koinkubation von Nabelschnur-Endothelzellen mit Serum von Malariapatienten und neutrophilen Granulozyten zur Apoptose der Endothelzellen. Die Apoptose kann durch Ascorbinsäure und Tocopherol (Antioxidantien) sowie durch Ulinastatin (Hemmstoff der Elastase) teilweise verhindert werden. Erste Beobachtungen haben gezeigt, dass diese Beobachtungen nicht nur für die Malaria, sondern auch für Sepsis durch Escherichia coli oder Staphylococcus aureus zutreffen. Dies bedeutet, dass Strategien zum Schutz des Gefäßendothels vor Apoptose, die für die Malaria tropica entwickelt werden, potenziell auch für die Sepsis nützlich sind, und umgekehrt.
Card-ii-Omics: Kardiovaskuläre Implantatentwicklung – Infektionen – Proteomics: Prävention, Diagnostik und Therapie von Implantatinfektionen
Laufzeit: 2017 – 2021
Der interdisziplinäre Forschungsverbund mit Partnern an den Universitätsmedizinen und Universitäten am Standort Rostock und Greifswald sowie dem Institut für Implantattechnologie und Biomaterialien e.V. in Warnemünde wird im Rahmen des Exzellenzforschungsprogramms des Landes M-V gefördert. Ziel ist es, Infektionen von kardiovaskulären Implantaten durch Biofunktionalisierung zu vermeiden sowie die Diagnose und Therapie dieser lebensbedrohlichen Komplikationen zu verbessern.
Koordinator des Verbundvorhabens ist Prof. Dr. med. univ. Emil C. Reisinger
Homepage Card-ii-Omics: http://www.card-ii-omics.med.uni-rostock.de
Schugi-MV
Das Projekt schugi-MV wird von den beiden Universitätsmedizinen Rostock und Greifswald im Auftrag der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns durchgeführt.
Schugi-MV hat zum Ziel, das COVID-19 bedingte Infektionsgeschehen an Schulen zu untersuchen, dieses auf mögliche Infektionsmuster hin zu analysieren und hieraus Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes unter Pandemiebedingungen empfehlen zu können.
Durch das Projekt soll neben der Möglichkeit, einen größtmöglichen Anteil des Unterrichts in Präsenzform durchzuführen, auch eine Planungssicherheit für LehrerInnen und Eltern unterstützt werden.
Das Schugi-Team Rostock:
Prof. Dr. med. univ. Emil C. Reisinger
Projektleitung Universitätsmedizin Rostock
Dr. rer. nat. Martina Sombetzki
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Dr. rer. nat. Manja Ehmke
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Anna Emmerich, M. Sc.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
(Informationen zum Schugi-Team der Universitätsmedizin Greifswald: http://www2.medizin.uni-greifswald.de/icm/ und https://www.medizin.uni-greifswald.de/de/ueber-die-umg/aktuelles/zentrale-erfassung-von-covid-19-antigen-schnelltests-zepocts/)
Klinische Forschung
Um die Ergebnisse bei der Behandlung unserer Patienten ständig zu verbessern, werden bei uns neben der Forschung im Labor mehrere klinische Studien durchgeführt. Mittelpunkt sind folgende Themen:
- Influenza-Vakzine
- Reiseimpfungen
- Clostridium difficile
- Antibiotic Stewardship
- Impfungen bei Immunsuppression
- Nadelstichverletzungen
- HIV
- Hepatitis C
Auch im Rahmen unserer ESTHER-Kooperation mit Kamerun (Limbe und Bamenda) und Guinea (Kindia) beteiligen wir uns an klinischen Studien.